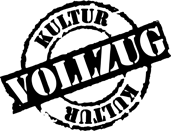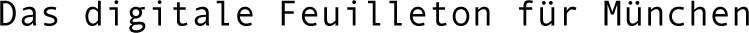Zum Auftakt des Festivals im Volkstheater
Radikal Jung - das erste Drittel
Das erste Drittel von Radikal Jung liegt hinter uns, Zeit für eine Zwischenbilanz. Von Körperkult, Psychosen und Klassendünkel. Und einem Abgesang auf Europa.
Für ihre kleine, feine Bühnenarbeit "Durée d'Exposition" beim Festival Radikal Jung im Münchner Volkstheater bedient sich Camille Dagen der Metapher des Fotos, um die Flüchtigkeit menschlicher Beziehungen zu zeigen. Ein Paar findet sich, ein Paar verliert sich, dazwischen: Freude, Liebe, Streit. "Durée d'Exposition" heißt das Spiel, "Belichtungszeit", es geht um die Bruchteile von Sekunden zwischen dem Druck auf den Auslöser und dem Zuschnappen des Verschlusses, jene magische, winzige Spanne Zeit, in der ein Bild in einen dunklen Kasten eingeht, ohne dass wir bis ins Letzte wüssten, was es darstellt. Diese Unsicherheit, diese Zeit des Wartens, in der ein Bild wundersamerweise alles sein kann, kennt man heute nicht mehr, aber man musste seinerzeit die komplizierte Prozedur vom Entwickeln der Filme und dem Abzug der Bilder noch abwarten.
Wandlung könnte man das nennen, und Regisseurin Camille Dagen und ihre beiden Akteure Thomas Mardell und Hélène Morelli übergeben diese Wandlung an den Zuschauer: Die Augen sind die Linse, entwickeln muss sich das Bild im Kopf des Betrachters. Die beiden erzählen von dem, was sie treiben, was sie können und was nicht. Morelli kann nicht auf Kommando weinen, Mardell behauptet, singen zu können. Was er mit ein paar Takten aus Schuberts "Winterreise" beweist. Und mit diesem tieftraurigen Liebesabschied ist denn auch der Ton vorgegeben: Es geht um vergangene Bilder der Zweisamkeit.
Mardell und Morelli zeigen im eigentlich etwas zu kleinen Nachtkasterl des Volkstheaters einen innigen, einen intensiven Abend (Bühne Emma Depold, Sounddesign Kaspar Tainturier-Fink). Gut eine Stunde lässt man Bild um Bild durch seine Pupillen wandern, eine Belichtungszeit von etwas über 60 Minuten. Am Ende haben sich ein paar Bilder eingebrannt und in die Erinnerung gebannt. Etwa wie Hélène Morelli einen Zuschauer zum Tanz auffordert. Die beiden tanzen zu Celine Dions Titanic-Song "My heart will go on forever" etwas, was man zu Zeiten der analogen Fotografie "Schieber" nannte. Sehr kitischig. Irgendwie auch wieder schön. Irgendwie alles zusammen, mit Glitterregen beim Refrain. Schwarzweiß gibt es da nicht.
Café Populaire
Nach "Kings" und "The Making-of" präsentiert Nora Abdel-Maksoud bereits ihre dritte Produktion als Autorin und Regisseurin bei Radikal Jung. "Café Populaire"vom Theater Neumarkt in Zürich spielt mit Klassendünkel und Klischees. Die bildungsbürgerliche Svenja (Eva Bay) ist ihres Berufslebens als Hospizclown überdrüssig. Ihre Chance wittert sie, als die "Goldenen Möwe", das erste Haus am Platze in Blinden, frei wird, inklusive Wohnung für den Wirt. Svenja sieht die Zeit für ihre eigene Bühne gekommen. Doch da erhält sie unerwartete Konkurrenz in Aram (Maximilian Kraus), dem Vertreter des Dienstleistungsprekariats, Masseur, Bote, Kellner und Pfleger in einem. Für sich und seine Familie sucht er eine neue, größere Wohnung, und die "Goldene Möwe" käme da wie gerufen. So bringt er sich bei Besitzerin Püppi (Simon Brusis) in Stellung, bei der Altlinken, die noch immer "vom bolschewistischen Stahlarbeiter mit hoher Streikneigung" träumt.
Moira Gilliéron hat sich, was Kostüme und die Farben des Lichts angeht, deutlich vom "Grand Hotel Budapest" inspirieren lassen. Nora Abdel-Maksoud wiederum setzt auf das bewährte Guckkasten-Format aus "The Making-of" und auf die wichtigsten Elemente ihrer zwei vorangegangenen Radikal-Jung-Produktion: Tempo, Sarkasmus, irrwitzigen Plot und herausragende Schauspieler, die über die unbedingt notwendige Präzision von Wort und Geste nicht das Spielen vergessen. Vor allem Eva Bay glänzt, mit Farben und Facetten, die im sehr schnellen Wechsel changieren.
Ein anstrengender Job, wahrlich, denn gehetzt wird sie ja nicht nur von ihren schlechten Berufsaussichten, sondern auch von ihrem abgespaltenen, bourgeoisen Alter Ego, dem Don (Stella Hilb), der so gar nichts von Zurückhaltung gegenüber dem hält, was er als Prekariat für sich einstuft. Mit einem Schnippen seiner Finger stößt der Don die ach so kultivierte Svenja vom Gleis des politisch Korrekten: Da wird der Klassenkampf zu einer Form des politischen Tourette--Syndroms.
Das alles ist, wie gesagt, hübsch anzuschauen, flott gespielt, man bewundert die souveräne, fast schon abgefeimte Leistung der vier Akteure, kudert beim einen oder anderen Scherz, den zu kapieren man schon irgendwie dazugehören muss - zum Bildungsbürgertum und seinen Chiffres. Wer gehört denn überhaupt dazu, was ist davon zu halten, dass auch hierzulande nicht nur Rassismus und Sexismus, sondern offenbar auch "Klassismus" - so erklärt das Svenja im Stück - grassieren? Dass die Reichen sich abgrenzen von den weniger Reichen, und dass erst recht sich die Bürger vom "Prekariat" abheben wollen, aus lauter Angst, bald selbst "dort unten" zu landen?
Nora Abdel-Maksoud handelt all diese Fragen sehr hip, sehr smart und sehr unterhaltsam ab und verfällt doch auch ab und an ihrerseits in die Muster, die Distinktion ermöglichen. Warum es okay ist, über "Arme" im Theater Witze zu machen, fragt die mittlerweile vollkommen zynische Svenja am Ende mit einem letzten Anflug ihres Clownshumors. Weil "die" eh kein Geld für Karten haben. Und - Licht aus.
Diese Pointe kam trocken. Wie ein Schlag auf die Nase. Oder unterhalb die Gürtellinie, kommt drauf an, in welcher Höhe man sich gerade wähnt.
Medusa Bionic Rise
Das "Auswärtsspiel" bei Radikal Jung, in einem weitestgehend leerstehenden Bürogebäude an der Zschokkestraße. The Agency beschreitet in der dritten Etage den kurzen Weg vom Körperkult zum Wahn von der Menschmaschine. Schauplatz: Eine Art Fitnessstudio mit Elementen von einer Menschenwerkstatt (Bühne Belle Santos). Künstlich wirkende Menschen tragen auf dem "Schlachtfeld des Körpers" (davon ist ab und an die Rede: Your body is your battlefield) den Kampf mit sich selbst aus, mit Kniebeuge, Faustkampfübung und Stepping, angefeuert von der rampenaffinen Stacyan Jackson, die den Eindruck erweckte, in ihrem vormaligen Leben Drillsergeant bei den Marines gewesen zu sein. Mal schweben sphärische Klänge durch den Funktionsbau, mal wummert aggressiver Techno, man kann in einem Konferenzraum Platz nehmen und sich Filme anschauen, in denen Kunden von "MBR", der fiktiven Firma "Medusa Bionic Rise", von ihren überwältigenden Erfahrungen mit körperoptimierender Technik berichten. Einmal meint man einen Ausschnitt aus Noam Brusilovskys letztjährigem Radikal-Jung-Beitrag "Orchiektomie rechts" wiederzuerkennen. Von Rahel Spöhrer im Lara Croft-Outfit (Kostüme Magdalena Emmerig) kritisch beobachtet, ahnt man den Beginn einer Art von Gehirnwäsche. Ein, zweimal geht ein Mensch kaputt, wird aber repariert, um sich gleich wieder unters Fitnessvolk zu mischen. Der Tod kann also doch ausgespielt werden. Ganz aufregend, das alles, zunächst jedenfalls. Schöne neue Welt mit ganz neuen Menschen in einer beeindruckend künstlichen Atmosphäre. Irgendwie aber bleibt blieb die serielle Bewegung der Menschmaschine das einzige, was sich an diesem Nachmittag bewegte. Ein bisserl wenig für ein großes Thema und geschlagene zwei Stunden.
Angstpiece
Schon widersprüchlich, diese Kunstform des Dramas. Da verhandeln Leute, die vorgeben, andere zu sein, Themen, die ganz real existenzielle Wichtigkeit haben. So war das zumindest mal, heute kann man sich da nicht immer sicher sein. Bei "Angstpiece" etwa, dem Radikal-Jung-Beitrag von Anta Helena Recke und Julia*n Meding, entstanden in Kooperation mit den Münchner Kammerspielen, Gassnerallee Zürich und Sophiensälen. Echt, nicht echt, wichtig, belanglos? Schwer zu sagen. Der Ausgangspunkt des Ganzen: Julia*n Meding leidet unter Agoraphobie, kann sich nur unter größten Problemen überwinden, auf die Bühne zu schreiten, ist aber leider paradoxerweise Theatermacher, vielmehr: Theatermacherin geworden, und nutzt nun den Kunstraum des Theaters eben als Therapiepraxis. Das kann man glauben, sollte es aber besser nicht, denn tatsächlich ist Julia*n Meding in dieser Form eine Kunstfigur. Deutlich wird das, als Julia*n Meding in den eingespielten Videosequenzen ganz anders spricht als der Akteur auf der Bühne, nämlich locker und selbstbewusst. Gedrückt, oder vielmehr nölend lässt sich nur der angeblich phobiengeplagte Mensch auf der Bühne vernehmen, in einer schier endlosen Erzählung von Krankheit und Wahn. Wozu das gut ist? Hm. schwer zu sagen. Julia*n Meding hat ein T-Shirt an, mit dem Aufruck "Destroy white supremacy". Der Mensch ringt also offenbar nicht nur mit Ängsten, sondern auch mit dem überkommenen System mit dem "weißen Mann" im Zentrum.
Phobie, Postkolonialismus, Ringen um die Deutung der eigenen Persönlichkeit als männlich oder weiblich? Irgendwie war alles ein bisschen dabei. Und damit ziemlich sicher nichts richtig. Nur ganz kurz flackert so etwas wie Theater auf: Als ein kleiner Junge Julia*n Mendigs Spielfeld mit Kugeln aus Nato-Stacheldraht, einem Spielzeug Pony und einer Hüpfburg stürmt und so etwas wie den Entwurf globaler Angstfreiheit ahnen lässt. Ansonsten: Ein fader, ein ärgerlicher Abend.
"Die Hauptstadt"
Nach dem Roman von Robert Menasse hat die Münchnerin Lucia Biehler fürs Schauspielhaus Wien "Die Hauptstadt" inszeniert. Ums vorwegzunehmen: Mit "Duree d'Exposition" war das die Inszenierung, die den Kulturvollzug-Kritiker im ersten Drittel des Festivals am meisten beeindruckt hat. Lucia Biehler durchleuchtet Brüssels Bürokratie sozusagen mit den Röntgenstrahlen des Theaters und wirft das Bild einer skurrilen Nebenwelt mit ganz eigenen (Bewegungs-)Abläufen an die Wand. Das ist mal komisch, mal alptraumhaft, aber überhaupt nicht realistisch und damit sehr wirklichkeitsnah. Brüsseler Beamte wollen die Idee der europäischen Einigung wieder auf den Boden der geschichtlichen Tatsachen stellen und an das Trauma von Krieg und Holocaust erinnern. Bei dem Versuch, zur großen zentralen Jubiläumsfeier der Europäischen Union Überlebende aus Ausschwitz einzuladen, verheddern sich die Beamten in den Fragen des Protokolls, der nationalen Befindlichkeiten und ihren eigenen Angelegenheiten. Schon die Suche nach Überlebenden gestaltet sich schwierig, scheint es doch keine Adressdatei zu geben. "Auschwitzüberlebende sind keine Alumni", sagt einer, meint es gar nicht böse und wirkt doch irgendwie gefühllos. Am Ende entwirft ein alter Professor das Bild eines gemeinsamen Projekts, einer neuen Hauptstadt, zu bauen nahe Ausschwitz, dem Ausgangspunkt der europäischen Idee. Sein Traum wird das Mausoleum dieses onyxgrünen Bar-Raums (Bühne Josa Marx) kaum verlassen, immerhin aber fühlt man noch einmal, was Europa für eine schöne, wichtige und bedrohte gemeinsame Sache ist. Die Geschichte wird erzählt von einem Barkeeper, der mit einem Fingerzeig die anderen Akteure einfrieren lässt, das Band vorwärts spult oder die Zeitlupe einschaltet. Diese Allmacht ebenso wie seine schwarzen Augenhöhlen weisen ihn als Tod und Meister des europäischen Geschehens auf. Bardo Böhlefeld ist mit seiner grotesken Körperlichkeit, seiner verzerrten Präsenz das Ereignis dieses Abends, der von einem insgesamt starken und konzentrierten Sextett getragen wird. Immer wieder wird Bardo Böhlefelds Erzählung von Störsignalen unterbrochen, verzerrt und zerhäckselt - so überzeugend hat man derlei seit den Frühzeiten des ultralahmen Internets nicht mehr gesehen. Warum der Barkeeper von einem offenbar beschädigten Speichermedium aus zu uns spricht, lässt sich nur erahnen. Es scheint sich eine Katastrophe ereignet zu haben. Ein Ausflug in die lächerliche Finsternis Brüsseler Bürokratie und an die Grenzen der Hoffnung für den Kontinent: stark.