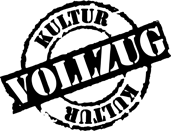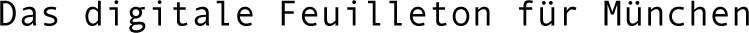Kleists "Erdbeben" am Residenztheater
Zeitgenossen im Ausnahmezustand
Rasender Stillstand, ein Text wie ein düsterer Song: Ulrich Rasche treibt am Residenztheater im "Erdbeben in Chili" einer Kleist-Novelle die Handlung aus und kommt damit Heinrich von Kleist beunruhigend nahe.
Man hört eine Erzählung, präzis und drängend gesprochen, in all der kristallinen Schönheit, die Heinrich von Kleist seinen Texten angedeihen ließ. Es wird viel geliebt und noch mehr gestorben in dieser Erzählung, ein spannender, ein dramatischer Stoff wäre das, den Ulrich Rasche hier auf die Bühne bringt.
Aber eigentlich geht es gar nicht darum, nicht um so etwas Banales wie die Katastrophe an sich, nicht konkret um das „Erdbeben in Chili“, stattgefunden im Jahre des Herrn 1647, auch nicht um Mord und Totschlag.
Es geht um mehr: Darum, was die Welt zusammenhält und auseinanderstreben lässt. Da wird nichts „verhandelt“, wie das immer wieder mal heißt, wenn beim Theater „Gesellschaftskritisches“ auf die Bühne gestemmt wird. Um Gesellschaft geht es sogar am allerwenigsten. Was da an Gesellschaft war, ist ja eben gleich zu Beginn zerstört worden. Man unterzieht sich vielmehr einer Meditation, die Gedanken kreisen über Widerspruch, über Spannung, über Gegensatz und Harmonie, über Schuld und Sühne, über kurzes Glück und über die stets vorhandene Möglichkeit der Verstörung. Es geht nichts weniger als alles, immer.
Und damit kommt Rasche Heinrich von Kleist möglicherweise beunruhigend nahe.
Kleist ist in seinen Erzählungen der Katastrophen-Künder schlechthin unter den Dichtern deutscher Sprache, der Bote der ultimativ schlechten Nachrichten. Ein Chronist mit verblüffender Technik: Wie er die Nahaufnahme eines einzelnen Menschen mit der Weitwinkel-Perspektive auf den Weltuntergang kontrastiert, ist groß. „Eben stand er, wie schon gesagt, an einem Wandpfeiler und befestigt den Strick, der ihn dieser jammervollen Welt entreißen sollte, an eine Eisenklammer, die an dem Gesimse derselben eingefugt war“: Man ist so nah an Jeronimo Rugera, dass man die Fugen am „Gesimse“ berühren zu können meint.
Und den Bruchteil einer Sekunde später wird man mit der Fortsetzung des Satzes quasi in die Totale geschleudert und Zeuge großen Grauens: „…Als plötzlich der größte Teil der Stadt, mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank, und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begrub.“
Das hat man schon gelesen, aber vielleicht zuvor nicht so wahrgenommen wie in diesem Hör-Spiel. Nähe und Distanz, auch das ist ein Gegensatzpaar in dieser Erzählung Kleists, der immer wieder das Schicksal Einzelner dem großen Weltgeschehen gegenüberstellt. Und auch Rasche setzt auf Gegensatz. Wieder präsentiert er seine Akteure auf kreiselnder Drehbühne, die Schauspieler können fürbaß schreiten und rühren sich doch kaum von der Stelle: Ein befremdender Anblick zunächst, schließlich ein starker Kontrast zur Dramatik der Erzählung.
Es treffen weiter die Gegensätze zusammen. Zwei Todgeweihte, die durch das Unglück, das die ganze Stadt trifft, dem Leben zurückgegeben werden; paradiesisch anmutende Harmonie nach der Katastrophe; der Ausbruch von Mordlust ausgerechnet in einem Gotteshaus, da alle Gefahren hinter einem liegen. Es ist ja alles so fragil, die ganze Welt, in der wir leben, so chaotisch, das man auch rational klingende Erklärungen nur glauben und nicht um ihre Richtigkeit wissen kann. Überall kann der Riss lauern, durch den sich Chaos Bahn bricht.
Ein Schauspieler- oder besser Stimmenkollektiv - Mareike Beykirch, Linda Blümchen, Pia Händler, Barbara Horvath, Thomas Lettow, Nicola Mastroberardino, Antonias Münchow, Johannes Nussbaum und Noah Saavedra - trägt Kleists Text vor. Drängend, dröhnend, drohend, flüsternd: ein Chor fast ohne Protagonisten, ein einziger Kommentar auf die Abgründigkeit des Daseins. Die Neun rhythmisieren den Text, mitunter hört sich's zu Nico van Werschs Musik (gespielt von von Heiko Jung, E-Bass, Lilijan Waworka, Keyboard, sowie von Fabian Löbhard und Fabian Strauss, Percussion) an wie eine elegische Variante von Rammstein.
Zwischendrin Ausbrüche: Man denkt laut nach über Corona-Pandemie, über den Klimawandel - und entdeckt die Menschheit als Brüder im Katastrophenzustand. Gestern das Erdbeben, gerade die Pandmie, morgen wieder Klimawandel - wir sind Zeitgenossen im Ausnahmezustand, nie weit entfernt vom Abgrund und jederzeit nicht in der Lage für eine sinnvolle Antwort.
Das alles spielt sich meist in einem Halbdunkel ab, das auf Dauer ebenso anstregend ist wie die Dauerbeschallung oder das Dröhnen des Textes. Rasche setzt lebende Bilder als Inseln der Erholung ein. Ein blaues Schimmern, eine Staublawine, Staubwolken, die sich über dahingestreckte Körpern entfalten - ein paradoxerweise unsagbar schönes Bild für die Zerstörung, den Weltuntergang, der über die Stadt gekommen ist. Die Bühne hat Rasche selbst entworfen, beziehungsweise weitesgehend belassen, mit dem Licht malte Gerrit Juda.
Der Abend bleibt trotzdem anstrengend. Kleists Textflächen auch nur zu folgen (geschweige denn, sie mit solcher Präzision im Kollektiv zu weben) ist harte Arbeit. Rasches Radikalität, die Reduzierung von Material auf der Bühne und Aktion, seine strenge Choreographie des rasenden Stillstands auf der Drehbühne, seine Art, die Art des Vortrags eher als den Inhalt zur Metapher für das Dasein zu machen, bieten dem Zuschauer wenig Erquickung. Aber Theater ist schließlich keine Revue, sondern Denkfabrik. Ja, man kann nicht nur die Bühne, sondern auch den Zuschauerraum schon auch als Arbeitsplatz sehen, als Werkbank für die Perspektivkalibrierung.
So fühen sich diese zweieinhalb Stunden mitunter spröde an. Aber: Man wird noch viel länger darüber nachdenken, über die Bilder, die haften bleiben. Über das, was uns vom Abgrund trennt.
Oder über das, was bleibt.
Schließlich ruht auch in Kleists Pandora-Büchse im Grunde die Hoffnung: "Und in der Tat schien, mitten in diesen gräßlichen Augenblicken, in welchen alle irdischen Güter der Menschen zu Grunde gingen, und die ganze Natur verschüttet zu werden drohte, der menschliche Geist selbst, wie eine schöne Blume, aufzugehn." Ein schöner Satz, hoffentlich wahr, dann und wann wenigstens.
Termine im Oktober: 4., 17. und 18. Oktober 2020