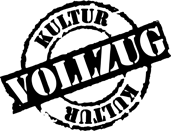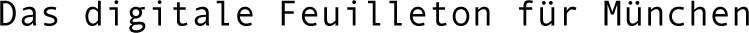Radikal Jung 2018
Viel Leben vor dem toten Rennen
Radikal? Bedingt. Jung? Auf jeden Fall. Und noch dazu gut: Die jüngste Auflage von "Radikal Jung" darf zu den besseren Jahrgängen des noch immer jungen Festivals gerechnet werden. Mit einem Sieg im Heimspiel: Das Publikum wählte die Volkstheater-Produktion "Children of Tomorrow" gemeinsam mit "Ja eh: Beisel, Bier und Bachmannpreis" vom Rabenhof-Theater auf den ersten Platz - zum zweiten Mal in der Festivalgeschichte gab es ein totes Rennen. Ein Rückblick in Ruhe.
Ob der Name des Festivals ein glücklicher Griff sei oder nicht, darüber wurde in den ersten Jahren von "Radikal Jung" diskutiert. Bei der insgesamt 14. Auflage war das nicht mal mehr ein Randthema. Der Name ist eingebürgert, für eine außerordentlich gut ziehende Theater-Marke mit eigenem Klang.
Für welche Art des Theaters das ominöse Wort steht, darf man sich aber schon noch fragen, am besten bei jeder einzelnen Inszenierung: umstürzlerisch, krass, heftig? Da haben wir in den vergangenen Jahren auf jeden Fall größere Schockmomente erlebt. Oder drückt es wegen der Abstammung vom lateinischen "Radix" die Hoffnung aus, dass es noch "an die Wurzel gehendes" Theater geben könnte? Man könnte aus der Ausbeute 2018 schon ein, zwei Beispiele herausziehen.
Kein Theater ohne Schauspieler mehr, kein Drama ohne Worte, kein Theater ohne Theater, Angebot statt Verweigerung: Insgesamt wurde wieder mehr erzählt, und das aus verschiedensten Blickpunkten. Und das in einigen Fällen durchaus unterhaltsam.
Wüst und melankomisch
Etwa in "Eh klar! Beisl, Bier und Bachmannpreis", einer Wiener Revue mit dem neuen Austro-Pop-Phänomen Voodoo Jürgens als "Schlagobersgupf", wie das Sahnehäubchen auf Wienerisch angeblich genannt wird. Nicht waaaahnsinnig aktuell und schon gar nicht radikal im politischen Sinne, aber in der Inszenierung und Zusammenstellung von Christina Tscharyiski ziemlich kurzweilig. Autorin Stefanie Sargnagel wird in drei Versionen auf die Bühne des Rabenhof-Theaters geschickt, verkörpert durch Miriam Fussenegger, Saskia Klar und Lena Kalisch, die einander bestätigen und widersprechen, was so ziemlich der Befindlichkeit von der ziemlichen Mehrheit von uns Heutigen entspricht. Es geht in dieser Textmontage um absurd fade Lohnschreiberei, die Sehnsucht nach einem seriösen Lebensentwurf, geäußert am Tresen, um Alibi-Sport und engagiert betriebene Saufabende, ein unentschlossenes Leben im entschiedenen Sinkflug, um die Bedürfnisse des Leibes und der Seele, barock, verkommen und angemessen morbid. Und weil ein bisserl Wien eh in fast einem jeden von uns steckt, kommt das fast einem jeden sehr lustig vor. Zu sehen gibt es auch noch was, weil sich das muntere Darstellerinnen-Trio in Sarah Sassens Bühnen-Schrankwand-Konstruktion auf abenteuerlichste Weise auf Matrazen fallen lassen und in Fächer falten kann. "Der Wandverbau in meinem seelischen Wohnzimmer", so heißt das unvermittelt poetisch in Sargnagels Sprache - man hat schon weniger Schlüssiges gehört. Nicht zuletzt wegen der zwar schwer verständlichen, aber unüberhörbar melancholischen und lebensecht schrägen Einlagen von Voodoo Jürgens und seinen drei Mitmusikern herrschte danach Jubel im Volkstheater.
Ebenso viel Zuspruch erfuhr das zweite Befindlichkeitsdrama des Festivals, die Volkstheater-Produktion "Children of Tomorrow", von Tina Müller, inszeniert von Corinne Maier. Julia Richter, Pola Jane O'Mara, Oleg Tikhomirow und Mehmet Sözer entwickeln eine Versuchsanordnung mit vier Atomen, die einander mal abstoßen, mal anziehen und als instabiles Molekül unterschiedlichste Vorstellungen durchspielen, wie Arbeit und Familie zu vereinbaren wären. Bunt, körperbetont, schnell, in dieser Machart nicht ganz jung, erst recht nicht radikal - aber unterhaltsam.
Star-Kult und Weltmarke
An die Wurzel gingen andere Stücke des Festivals. Etwa "Don't worry, Be Oncé XS edition", eine Performance, die bloßlegt, worin ein Markenname im Pop-Business wurzelt, getarnt als Bootcamp für alle, die den Star in sich wachküssen möchten. Vorbild ist Beyoncé, die in einer Person Diva, Künstlerin, Nachahmerin, Sexsymbol und feministisches Vorbild ist, das eine weniger, da andere etwas mehr, die vor allem aber erfolgreich ist. Stephanie von Batum, die auch Regie führte, und Stacyian Jackson zeigen, wie's geht und vor allem, wie sich's tanzt. Schnell, beeindruckend wird getanzt, leider nicht ganz zum Irrwitz überdreht, mit dem ungewöhnlichsten Publikum der bisherigen Festivalgeschichte: So viele junge Fans, Fashion Victims und Kreischwillige sieht man sonst nicht. Es genügt als Fan-Magnet, wenn der Name Beyoncé wenn auch nur verfremdet im Titel eines Stücks auftaucht.
Poesie und Grauen
An die Wurzeln der modernen Kriege führt mit einem ganz alten Begriff "Das Skelett eines Elefanten in der Wüste" von Ayham Majid Agha, der in diesem Stück fürs Maxim-Gorki-Theater Berlin auch Regie führte. Das Publikum sitzt auf Stufen wie um eine rechteckige Manege herum, in einem dunklen Kubus, den man zuvor einige Male umschreiten sollte wie der Pilger die Ka'aba. Schauspieler erzählen mal in der Manege, mal von außen über die Wände des Kubus von Scharfschützen, im Kriege verwahrlosten Tieren und anderen Unglücken. Ein "Kriegstheater", das durch seinen poetischen Ton zu schrecklichen Vorgängen überraschte. Und ebenso wie im Barock - daher kommt der Ausdruck Kriegstheater - erzählt Agha von der Gewalt und den medialen wie ästhetischen Mustern und Mitteln, mit denen die Öffentlichkeit sich ihr Bild vom Konflikt macht. Man sieht Aufnahmen aus einer zerstörten syrischen Stadt und hört dazu Vogelgezwitscher - eine Ton-Bild-Schere, ein Riss in der Leinwand unseres Bildes, durch den eventuell einmal das Licht der Erkenntnis fallen kann. Die angehenden Kritiker des Studiengangs der Theaterakademie August Everding kürten diese Produktion.
Schrille Grenzgängerin
An die Wurzeln der eigenen Existenz führte den jungen Israeli Noam Brusilovsky seine Hodenkrebserkrankung. Seine Performance "Orchiektomie rechts" vermochte dennoch nicht zu fesseln. Ein Krankenbericht mit Andekdoten, mehr Selbsttherapie als Theaterding, zur Formlosigkeit zerfasert, mit einem Traum von Lust und Körpersäften, den der eine als dionysisch lobte, die anderen aber als exhibitionistisch bekrittelten. Interessantes Thema, selbstverliebte und damit fade Umsetzung.
Die Wahrheit macht euch frei: "Not letting it in", eine freie Produktion von Jason Danino Holt bringt Performer im Theaterraum an einen Tisch. Man bekennt einander Macken, Untaten und kleinere Vergehen und lädt das Publikum in den sechseinhalbstündigen Beichtmarathon mit ein - man darf ebenfalls bekennen. Die Frage ist: Will man das überhaupt? Hat man das nicht ohnehin schon, aus Versehen, neulich, auf Facebook? Und: Wenn man auch ins Theater geht, weil man will, so bleibt man doch eher sitzen, wenn man muss. In "Not letting it in" musste man nicht, man konnte auch wieder gehen. Man durfte es sogar. Vor allem, wenn man eine der drei anderen Vorstellungen jenes Donnerstags sehen wollte.
Dazu gehörten die erwähnten "Orchiektomie" und die Beyoncé-Performance, aber auch die schrille "Animal Show" von Marina Frenk: Dada-Reenactment, das Irrwisch Marina Frenk der Schauspielerin Valeska Gert widmete. Aus einem pinken Sarg heraus bringt die Performerin, die als "entartet" verfemte und von der Exilgemeinde als "Schande für die gesamte Emigration" geschmähte Grenzgängerin zurück ins Leben - ab und an durch Erzählungen, mehr durch Bilder, Lautstärke, Assoziationen - Gefühle. Diese Suche nach dem nächsten Judenwitz - ist das noch Kunst oder muss das längst weg? Der Abend verunsichert, amüsiert und verärgert, trifft aber damit genau: Affe tot, Operation gelungen.
Überraschende Abschlussarbeit
Vielgestaltig ist das Angebot. Da findet sich eine insgesamt eher biedere Inszenierung wie die von Pinar Karabuluts "Romeo und Julia"-Verspiegelung (Schauspiel Köln) neben einer echten Überraschung wie Philipp Arnolds Fassung von Werner Fassbinders "Tropfen auf heiße Steine" (Deutsches Theater Berlin). Pinar Karabuluts Regie lässt vor allem die Nebenrollen von Mercutio und Thybalt aufblühen. Überhaupt gelingen ihr viele Einzelheiten, nicht aber das große Ganze. Ihre Figuren treffen einander auf dem Maskenball, die jungen Liebenden in spe sind als Totenköpfe geschminkt: Man weiß ja eh, wie's enden wird, und Karabulut hat auch nicht vor, daran sehr viel zu ändern. Dass sich ihre Figuren im Plexiglas-Drehtüren-Labyrinth verirren und - so ist das Leben - nur in Ausnahmen zusammenfinden, ist ein guter Einfall, der sich am Ende aber auch schon aufgebraucht haben wird.
Pinar Karabulut, die am Volksthater in der vergangenen Spielzeit "Dogtown Munich" inszenierte, hatte ihr Radikal-Jung-Debüt mit "Invasion" von Jonas Hassen Khemiri gefeiert. Der schwedische Autor war 2018 auch wieder vertreten, mit "Alles was ich nicht erinnere, fürs Schauspiel Köln von Charlotte Sprenger inszeniert. Diese Adaption eines Romans, dieses Forschen darüber, was von einem bleibt, der aus welchen Gründen auch immer "von uns gegangen" ist, beginnt flott, baut dann aber stark ab. Die Erinnerungen der Freunde geben nur einen Umriss des Verstorbenen ab, oder besser eine eine Art Fotonegativ, das mehr verunklart als erklärt - das haben wir bald verstanden. Insgesamt nimmt sich dieses Bühnenprojekt zu viel Zeit und zu viele Worte, und das trotz guter Schauspieler.
Von "Tropfen auf heiße Steine" war schon die Rede. Eine der besten Produktionen von Radikal Jung 2018 und dabei erst eine Abschlussarbeit. Man würde von Philipp Arnold gerne bald noch mehr sehen. Da passte viel zusammen: Ein Klaustrophobie schürender Guckkastenraum, dessen Wände den Akteuren mal weniger, mal noch weniger Spielraum geben (Bühne: Viktor Reim); da waren die düsteren, seltsam formlosen Kostüme von Julia Dietrich. Und hervorragende Schauspieler, allen voran Bernd Moss als Leopold Blum, der Philipp Arnold wie in einem expressionistischen Film in ein Quartett des Begehrens treibt. Aberwitzig komisch, manchmal, stets aber düster, wie Leopold, Franz, Anna und Vera umeinander ringen, ohne Rücksicht auf Verluste. So wird zum Franz Kafka zum Patenonkel eines Fassbinder-Stücks.
Sehenswert auch Ray Bradburys "Fahrenheit 451" vom Schauspiel Stuttgart: Regisseur Wilke Weermann bewegt seine Akteure wie Avatare durch eine Welt, in der Konsum und noch mehr Konsum alle Widersprüche überdecken soll. Bücher stören da nur und müssen vernichtet werden. Mitunter faszinierend, nicht ohne Komik, alptraumhaft, wie die Menschen freiwillig und ohne Zwang das echte, analoge Leben aufgeben.
Die Schwarzkopie
Vom Rassismus an "weißen" deutschen Stadttheatern, die Rollen für Schauspieler nur im Nebenfach kennen, erzählt zwar nicht Josef Bierbichler in seinem Roman "Mittelreich",aber dafür Anta Helena Recke in ihrer Kammerspiele-Kopie der "Mittelreich"-Inszenierung von Anna Sophie Mahler, ebenfalls an den Kammerspielen. Schon seltsam: Das Buch und damit das Drama um die Familie des Seewirts spielt am Starnberger See, ist geschrieben von einem Bier-Bichler, der nur aus Bayern stammen kann, es erklingt dazu Brahms "Deutsches Requiem", und da spielen schwarze Schauspieler. Das befremdet am Anfang, so lange, bis man sich fragt, was einem daran fremd sein soll. Und ob das nicht "den andern" genau so geht, deren Geschichte ja meist von den Weißen erzählt wird. Es geht nicht darum, welche Fassung "besser" ist. Es geht nur um den kleinen Unterschied. Ein radikaler Einfall, der einen die Perspektive wechseln lässt. Ist man in der Oper womöglich schon weiter? Jedenfalls würde ein, sagen wir mal, koreanischer Heerrufer in der deutschesten aller Opern kaum noch Widerspruch wecken. Die Masterclass der Theaterakademie August Everding kürte jedenfalls "Mittelreich".
Was noch bleibt, war einer der poetischen Momente dieses Festivals.
Regisseurin Marie Rosa Tietjen und Schauspielerin Birte Schnöink haben sich Wolfgang Herrndorfs "Tschick"-Nachfolger vorgenommen, "Bilder deiner großen Liebe". Isa erzählt die Geschichte weiter, man weiß nicht, ob sie unter Drogen steht, ob sie phantasiert, ob sie träumt oder ob vielleicht gerade alles gleichzeitig passiert. Tietjens zurückgenommene sachte Regie und Schnöinks faszinierendes, präzises Spiel verbinden sich zu einem der glücklichsten Abende bei Radikal Jung. Da wird ein Scheinwerferkegel zum Sonnenball, den Isa als Titularkönigin von Kastilien und Aragon und Herrscherin ihres Universums mit einem Finger aufhält. Wer sich in diesen Abend nicht in Birte Schnöink als Isa verlieben konnte, hatte womöglich gerade seinen Sinn für Theater-Magie verlegt.