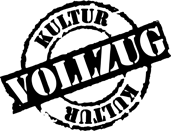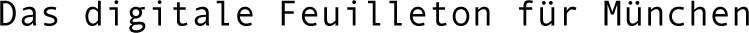Eine Bärenauslese am letzten Tag der Berlinale 2015
Mut muss belohnt werden
Der Himmel über Berlin hat sich wieder aufgehellt und auch der zwischzeitlich abgebremsten Konkurrenz im Wettbewerb wurde am Mittwochabend wieder ein Licht aufgesetzt. Das lag – recht unerwartet – am walisischen Universalkünstler Peter Greenaway, der für sich die Lust am Filmemachen neu entdeckt hat. Schon jetzt ein klarer Favorit auf einen der Hauptpreise des Festivals. Was bleibt also nach mehr als einer Woche Berlinale wirklich hängen? Welche Wettbewerbsbeiträge können sich ernsthaft Chancen ausrechnen? Höchste Zeit für eine persönliche Bärenauslese.
Wenige Glanzlichter im Wettbewerb
Die ersten Journalisten-Kollegen sind bereits abgereist, der Preis der deutschen Filmkritik wurde schon an Johannes Nabers „Zeit der Kannibalen“ vergeben und Wim Wenders wird schließlich noch mit dem Ehrenbären ausgezeichnet. Allmählich kehrt mehr Ruhe ein, der Festivaltrubel flaut merklich ab. Ein guter Moment also, um als einer von 3700 Filmkritikern Rückschau zu halten auf einen insgesamt durchschnittlichen Wettbewerb, in dem jedoch ein paar echte Diamanten dabei waren.
Preiswürdig:
Außer Atem in der Hauptstadt – zu Sebastian Schippers „Victoria“
Nach Fatih Akins Triumph mit „Gegen die Wand“ (2004), könnte diesmal tatsächlich wieder ein deutscher Beitrag das Rennen um den Goldenen Bären im Wettbewerb machen. So sehen es zumindest viele ausländische Pressekollegen. Zurecht, wie ich finde. Denn die ersten 20 Minuten von Sebastian Schippers ultrarasantem Berlin-bei-Nacht-Film sind schier der Wahnsinn! So präzise wie zärtlich, so akrobatisch wie enigmatisch tänzelte schon lange kein Kameramann (Phänomenal, der erst 30-jährige Sturla Brandth Grovlen) durch einen eigentlich düster-schlichten Plot, der im Prinzip schon in wenigen Sätzen erzählt ist: Eine junge Zugezogene (Laia Costa) aus Spanien, jobbt für einen Hungerlohn in einem Berliner Bio-Kaffee, anstatt weiter an ihrer Pianisten-Karriere zu feilen. Mitten in einer Kreuzberger Techno-Club-Nacht kreuzt sich ihr Weg mit einer Clique dumm daher schwatzender Poser, ehe sie sich in „Sonne“ (Frederick Lau in seiner bisher besten Rolle), den Kopf der wilden Bande, verliebt - und spontan für sich entscheidet, zusammen mit den Junges ein krummes Ding zu drehen. Der technische Coup, diesen rauen Undergroundfilm in einer einzigen Einstellung zu drehen, geht tatsächlich auf. Schnitte würden da eh nur stören, denkt man sich permanent, denn der filmische Sog ist von Beginn an enorm. Nach über zwei Stunden war ich ebenso erschöpft wie die Hauptdarsteller dieses - schon jetzt historischen – deutschen Beitrags im Wettbewerb. 140 Minuten Adrenalin-Rausch, nicht ohne Makel, aber Sebastian Schipper sollte sich schon mal den Smoking herauslegen. Denn dieser Mut, einen deutschen Film gegen den Strich, frei von Konventionen und derart waghalsig in der technischen Umsetzung zu machen, muss zwingend belohnt werden.
Burn-Out-Phantasmen am Strand von Santa Barbara – zu Terrence Malicks „Knight of Cups“
Dass dieser Beitrag die Gemüter erhitzen würde, stand von vornherein fest. Wer der Trailer gesehen hatte und wem das schmale, aber bedeutsame Oeuvre des Amerikaners Terrence Malick (Goldener Bär 1999) halbwegs bekannt war, der musstewissen, worauf er sich einließ. So ist es auch diesmal gewesen, nur noch eleganter oder widerlicher, je nach Standpunkt. Denn das Phantom Mr. Malick, der die Öffentlichkeit wie der Teufel das Weihwasser meidet, schickte wieder einmal nur seine Akteure (Christian Bale und Natalie Portman) zur Pressekonferenz. Der Rest ist Malick-Exegese. Hier ein Versuch: Schöner Wohnen in Hollywood oder die Sinnsuche des Herrn Bale. Pure Schönheit, wohin das Auge reicht. Meeresbrandungen, Sonnenuntergänge, dazwischen ein Erdbeben am Anfang und kleinere Wetterkapriolen am Ende. Leichtfüßig zusammengehalten durch zahllose Bewegungsschnitte. Dazu ein zweistündiges Off-Stimmen-Gewitter aus dem Unbewussten der Hauptfigur Nick (Christian Bale), einem erfolgsverwöhnten Gagschreiber aus der schwerreichen US-Entertainmentindustrie. Dazwischen montiert die attraktivsten Frauenkörper der jüngeren Kinogeschichte, die Nick, den stummen Antihelden dieser theosophischen Hochglanzstudie, bloß noch am Rande befriedigen können. Denn es geht Malick ums große Ganze, um den Weltgeist, den höheren Sinn des Lebens und den Versuch des Menschen, dieses wärmende Momentum namens Liebe irgendwie dingfest zu machen. Drunter macht er es nicht mehr, spätestens seit „The Tree of Life“ (2011) und „To the Wonder“ (2012) ist das so. Ohne Beziehungskrisen, Armut in den Straßen von L.A. und natürlich den ewigen Feind des Seins, den Tod, auszusparen. Der sitzt grell erleuchtet, im Neon-Look einmal sogar selbst auf dem elektrischen Stuhl. Natürlich hinter einer Maske. Soviel Geheimnis muss dann bei Malick doch noch sein. Ihm könnte diesmal der Bär für die beste Regie zugeschickt werden. Denn kommen wird er sicherlich nicht.
Enttäuschend:
Leipzig ist nicht das neue Berlin – zu Andreas Dresens „Als wir träumten“
Aus Rico (ein neues Gesicht: Julius Nitschkoff) soll ein Boxer werden, dafür kämpft er schon jetzt. Auf der Straße wie in seinem Inneren. Doch ihm fehlt schlicht der Biss, sich zu schinden. Disziplin ist ein Fremdwort in seinem persönlichen Kosmos. Stattdessen rauft er sich leidenschaftlich im Kiez, ist Drogen und Sauftouren nicht abgeneigt. So kann das natürlich nichts werden, was man sich zuweilen auch bei Andreas Dresens Regie denkt: Obwohl für seine Verhältnisse relativ laut, deutlich rüder in der Sprache als sonst und manchmal sogar mit Schwung, fehlt seiner Verfilmung des populären Clemens-Meyer-Romans „Als wir träumten“ das Subtile wie das Rauschhafte. Die Boxkämpfe werden unnötig in Rückblenden mit eingefügten Parallelmontagen inszeniert, ebenso der Blick zurück in den längst vergangenen DDR-Alltag. Trotz einer munteren Stoffvorlage versteht es Dresen nicht, echte Rebellionsmomente auf die Leinwand zu bannen. Bomberjacken, Pickel und Stroboskoplichter zeigen eben noch lange kein wildes Leben im chaotischen Leipzig der Wendezeit. Nicht einmal die Drehbuch-Dialoge des Defa-Altmeisters Wolfgang Kohlhaase können da noch viel retten. Schade um die Vorlage, die von Dresen wenig packend und stets zu brav umgesetzt wurde. Vom „Wilden Osten“ ist nicht zu sehen.
Überraschend:
Die Entjungferungsmaschine der digitalen Filmkunst – zu Peter Greenaways „Eisenstein in Guanajuato“
Ein Genie des frühen Kinos (Eisenstein) wird von einem späteren (Greenaway) inszeniert. Kann das gut gehen? Vor allem, nachdem sich das lebende britische Universallexikon der Filmgeschichte schon seit Jahren vom klassischen Medium verabschiedet hatte. Seit Jahr und Tag verkündet Greenaway den „Tod des Kinos“, ob als Professor an Filmhochschulen oder als viel gebuchter Panelkandidat unter Fachleuten. Nach der verunglückten Fellini-Hommage „Eight and a Half Woman“ (1999), dem Multimedia-Kunst-Exzess „The Tulse Luper Suitcases“ (2004) in 350 (!) Minuten und dem zuletzt mauen „Goltzius and the Pelican Company“ (2012) rechnete wirklich keiner mehr mit dem Mann, der das postmoderne Kino der 1980er Jahre entscheidend geprägt hatte. Sein intellektuelles „Cinéma de look“, das ebenso verspielt wie zynisch die Grammatologie des Geschichtenerzählnes neu erfand, ohne Rücksicht auf Zuschauergewohnheiten, war lange Zeit stilbildend. Doch um die Jahrtausendwende hatte sich der begeisterte Technikfreak nur noch in digitalen Mätzchen verzettelt. Der Motor stotterte gewaltig. Umso vitaler präsentierte sich der Waliser, der die anschließende Pressekonferenz, wie erwartet, zur unterhaltsamsten des ganzen Festivals machte, nun im Wettbewerb. Es geht um Eisenstein, um Mexiko, um Kunstmachen in der Fremde – und vor allem um die Entjungferung des sowjetischen Starregisseurs. Zu bestaunen in dem wortwörtlich visuellen Höhepunkt der Berlinale in der Mitte des hochartifiziellen Biopics: Ein rotes Fähnchen steckt im Hintern Eisensteins (preiswürdiger Struwwelpeter: Elmer Bäck) nach dessen erstem Analsex mit seinem Compagnero (Luis Alberti). Raffiniert verwoben (Kreisnarration), technisch auf dem gewohnt neuesten Stand (Multi-Split-Screens) und mit den traditionellen Meta-Klammern (Sex und Tod) hat Peter Greenaway im Wettbewerb formal gezaubert wie kein anderer. Ob er nun den Preis für die beste Regie gewinnt oder nicht: Er hat vor allem die Lust am Filmemachen wieder entdeckt. Das Kino steht damit schon mal als erster Sieger fest.
Simon Hauck