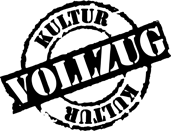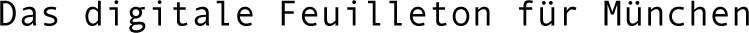"Schwimmen lernen" von Marianna Salzmann bei "Radikal Jung"
Aus witzig wird erschreckend wird komisch
Regisseur Hakan Savaş Mican ist im Volkstheater mit "Schwimmen lernen" zu Gast, eine Produktion des Berliner Maxim Gorki Theaters. Das Stück von Marianna Salzmann verbindet mit Musik und Schauspiel, Deutsch und Russisch - was gut zusammenpasst. Trotzdem sind die Figuren gespalten. Vor allem, wenn es um die Liebe geht.
Feli (Anastasia Gubareva) liebt Pep (Dimitrij Schaad), und Pep liebt Feli. Dabei ist es ganz egal, dass sich die beiden erst seit fünf Wochen kennen. Ihre Liebe ist so groß, dass sie sofort heiraten. Sonntagsfrühstück, Kirchenchor, Familienfeste. Pep fängt an, die Bühne mit Geranien zu schmücken. Ein Meer aus Spießigkeit. Doch als der Traum von Feli und Pep in Erfüllung geht, ist er auch schon wieder vorbei. Feli liebt Pep nicht mehr, sondern Lil (Mariana Frenk). Mit der will sie ans Schwarze Meer fahren.
Im Herbst 2013 hatte „Schwimmen lernen“ auf der Studiobühne des Maxim Gorki Theaters in Berlin Premiere gefeiert. Sie wird von Marianna Salzmann geleitet, der Autorin des Stücks. Nun war Regisseur Hakan Savaş Mican bei Radikal jung zu Gast, um Fragen nach Identität und Heimat auf die kleine Bühne des Münchner Volkstheaters zu bringen. Der Regisseur selbst ist Deutsch-Türke. Seine drei Darsteller sind in Moldawien, Moskau und Kasachstan geboren. Salzmann, die als Nachwuchstalent der deutschen Dramatik gilt, ist in Wolgograd geboren und in Moskau und Deutschland aufgewachsen. Ganz im Sinne des post-nationalen Labors, das Salzmann auf der Studiobühne des Gorki Theaters eingerichtet hat, werden kulturelle und sprachliche Barrieren in „Schwimmen lernen“ aufgehoben, um das Theater zu einem Ort zu machen, an dem Zuschreibungen von außen und die Möglichkeit der Bestimmung der eigenen Identität neu verhandelt werden können.
Nicht umsonst hat sich die Berliner Bühne unter der Intendanz von Shermin Langhoff das Label „post-migrantisches Theater“ auf die Fahnen geschrieben. Wohl auch deshalb, um sich frei zu schwimmen von Klischees und Erwartungen. Wenn man von den Schwierigkeiten absieht, die mit dem äußerst beliebten Präfix „post“ verbunden sind, verspricht das einen neuen Ansatz. So ist die Frage nach einer kulturellen oder sprachlichen Heimat bei „Schwimmen lernen“ nicht das Entscheidende. Es geht mehr um ein emotionales Zuhause, das in einer Liebesbeziehung gesucht wird. Die Figuren sind dabei hin und her gerissen zwischen dem Wunsch nach maximaler Geborgenheit und maximaler Freiheit, die überall zu finden ist – außer dort, wo man gerade ist.
Feli will raus aus dem zu real gewordenen Traum mit Pep und rein in einen anderen, aufregenderen. Aber es ist schon vorher kaputt gegangen. „Ich gehe jetzt duschen und dann machen wir Kinder“, sagt Pep zu Feli, die vor Eifersucht brodelnd auf ihn gewartet hat. „Oder ich erhäng' mich“, entgegnet sie. „Oder mich. Wie du willst. Lass uns was zusammen machen.“ Es sind diese Dialoge, die ins Leere laufen und eine große Einsamkeit offenbaren, mit denen „Schwimmen lernen“ beeindruckt. Sie sind messerscharf, doch gleichzeitig so komisch, dass das Publikum nicht anders kann als angesichts der Absurdität dieser Beziehung, die doch eigentlich eine Liebesbeziehung sein sollte, zu lachen. Mal mehr und mal weniger verhalten.
Und dann wird auf dieser Bühne, die nicht nur Theater-, sondern auch Konzertbühne ist, Musik gemacht. Das verspricht schon der Untertitel des Stücks: „Ein Lovesong“. Passend dazu besteht auch das einfache Bühnenbild neben den unvermeidlichen Geranien und der genauso unvermeidlichen Videoprojektion vor allem aus Instrumenten und Mikrofonständern. Zwar ist die mediale Kombination von Musik und Schauspiel auf den Theaterbühnen, die kaum mehr ohne eine Videoinstallation auszukommen scheinen, nicht wirklich etwas Neues, doch passt sie hier gut ins Konzept.
Das Rezept, mit dem das Theater versucht, sich ein Stück weit neu zu erfinden, ist einfach und legitim: Es arbeitet mit den Mitteln und Realitäten, die da sind. Gemischt wird bei „Schwimmen lernen“ somit nicht nur Musik und Theater, sondern auch Russisch und Deutsch. Das funktioniert gut, denn die Probleme lauern woanders. „Das hier ist für immer“, sagt Feli, die diese Erwartungshaltung wahrscheinlich in irgendeinem Lovesong aufgeschnappt hat. Mit Lil will sie ans Schwarze Meer. Das Meer bleibt jedoch immer nur eine Projektion an der Wand, die für einen Moment lang alles etwas einfacher und zärtlicher macht – bis erneut das Licht angeht und die Figuren umso heftiger aneinanderprallen. „Wenn wir das hier schaffen, dann mache ich irgendwas“, sagt Feli und die Verlorenheit, die hinter ihren Worten klafft, scheint ebenso weit wie dieses Meer, das sie nie sehen wird. Was erst Liebe war, schlägt in sein Gegenteil um. „Wo ist es denn anders?“, fragt Pep und verrät damit die Angst, dass es nirgendwo und vor allem mit niemandem anders ist.
Womöglich braucht es neben den Liedern auch die Genremischung, damit die Zuschauer bei „Schwimmen lernen“ nicht in Trübsal und Depression verfallen: Sehr komisch und fast schon grotesk knattert Anastasia Gubareva mit Zuckerwattebart am Kinn Bob Dylans „Just Like A Woman“. Lils Freundinnen, in deren Rollen Pep und Feli schlüpfen, wirken wie Karikaturen, wenn sie wie aus einem Mund eine Plattitüde nach der anderen abfeuern, um ihr dann wütend ihr gesammeltes Unverständnis entgegen zu brüllen. „Wir tragen das schwere Los, die Kleinfamilie gut zu finden.“ Das ist erst witzig, dann erschreckend und dann doch fast zum Schreien komisch.
Ana Maria Michel
Mit „Hurenkinder Schusterjungen“ von Regisseur Tarik Goetzke ist bei Radikal jung am 12. April 2014 ein zweites Stück der Dramatikerin Marianna Salzmann zu sehen. Das Festival läuft noch bis zum 13. April 2014 im Volkstheater. Mehr Informationen hier.